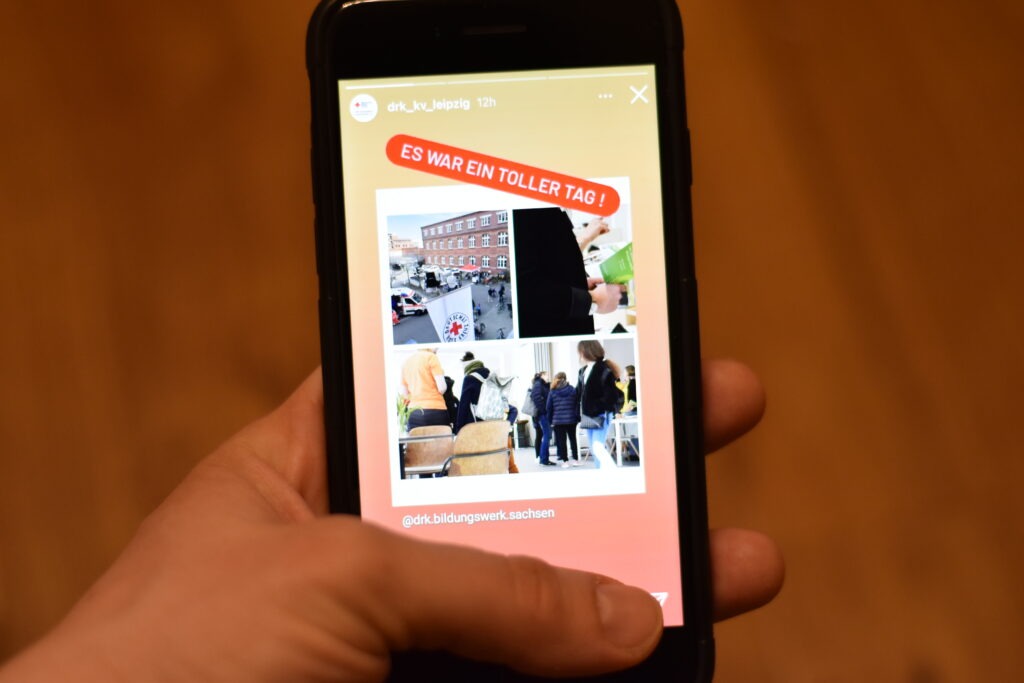Menschen vertrauen dem, was sie kennen. Und am Besten kennt jede:r sich selbst. In mehreren Studien haben die Psycholog:innen Yarrow Dunham, Andrew Scott Barron und Susan Carey erforscht, wie es sich auswirkt, wenn man Kinder in zwei Gruppen einteilt – die eine Gruppe wird in blaue T-Shirts gesteckt, die andere in rote. Die Farbe der T-Shirts hatte im Experiment-Setting keine weiteren Konsequenzen. Dennoch vertrauten die Kinder sehr schnell denjenigen Altersgenossen mehr, die die gleiche Kleidungsfarbe trugen. Sie interagierten mehr mit ihnen und fingen gleichzeitig an, denen mit der anderen T-Shirt-Farbe mehr zu misstrauen.
Solcherlei Studien werden häufig als Beleg für die tiefsitzenden Ursachen von Rassismus herangezogen. Was hierin aber auch zu erkennen ist: Wir müssen nur irgendeine Gemeinsamkeit mit anderen Menschen erkennen, um schneller eine Bindung aufzubauen. Treffen wir im Video-Call auf Fremde, dann stehen wir ja womöglich auf die gleiche Band, haben den gleichen Lieblingsfilm oder mögen dasselbe Gericht – auch wenn wir anders aussehen oder aus ganz unterschiedlichen Regionen kommen. Indem wir herausfinden, was wir gemeinsam haben, können wir Trennendes überwinden.

Photo by Yerlin Matu on Unsplash
Gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen
Gemeinsam gehen Menschen durch dick und dünn – und das schweißt zusammen. Weil man gelernt hat, der anderen Person zu vertrauen. Und weil man eine gemeinsame Geschichte erzählen kann. Treffen wir im digitalen Raum auf Fremde, kann es Vertrauen fördern, spielerisch auszuprobieren, ob auf die anderen Menschen Verlass ist.
Der beste spielerische Weg, das herauszufinden, sind Spiele! Sie geben einen geschützten Rahmen und machen Spaß. Gleichzeitig entblößen sich alle ein bisschen, weil Spiele eine gewisse Peinlichkeitshürde haben – manche Spiele mehr, andere weniger. Auch das erzeugt sozialen Kitt. Manche Spiele spielt man, indem man in der analogen Welt vor laufender Kamera die gleiche Aufgabe löst (Grimassen schneiden, Karaoke singen, eine Gymnastik-Übung o.ä.), andere Spiele finden gemeinsam im Digitalen statt (Minecraft, Autorennen oder Pixel-Art im Tabellenkalkulations-Programm).
Vertrauen ist gut, Erkennen ist besser
Wo in der Offline-Welt gerade vielerorts Maskenpflicht herrscht, gilt im Digitalen genau das Gegenteil: Kamera an! Denn Menschen vertrauen, wenn sie sich gegenseitig sehen können. Dann erkennen sie die Pupillen in den Augen der anderen Person, können Gestik und Mimik deuten.
Den “Blick in die Kamera” kann man übrigens üben: In Video-Calls neigen die meisten Menschen dazu, den Bildschirm anzuschauen – und damit ihren Blick immer ein paar Zentimeter unter die Laptop-Kamera zu senken. Das Gegenüber fühlt sich aber mehr beachtet, wenn wir ganz bewusst hin und wieder direkt in die Laptop-Kamera blicken. Das geht noch einfacher, wenn ihr euere Videokonferenz-Software nicht unten, links oder rechts an den Bildschirm schiebt, sondern die Miniatur-Ansichten euerer Gesprächspartner am oberen Bildschirmrand kleben – nur wenige Millimeter unter euerer Laptop-Kamera.
Achso: Klar ermöglicht das Internet den Schutz der Anonymität. Das Netz ist voll von Avataren und Fake-Profilen. Beim Thema Soziale Nähe gilt aber: Wer sich versteckt, der hat etwas zu verbergen – und das erzeugt Misstrauen.

Implizites wird explizit
Gestik und Mimik, Ironie und Sarkasmus: Viele Informationen, die uns aus der Offline-Welt implizit erreicht haben, funktionieren im Internet anders.
In der Facebook-Community Online Facilitator haben wir uns mit mehr
als 400 Coaches und Moderator:innen zusammengetan, um unsere Erfahrungen aus Workshops, Meetings und anderen Online-Formaten zusammenzutragen. Wir alle stellen fest, dass es im Digitalen enorm schwierig ist, zu erspüren, welche Stimmung in Gruppen herrscht.
Daraus folgt: Im Digitalen muss das, was früher implizit war, explizit gemacht werden. Wenn jemand genervt ist, dann genügt ein genervter Blick nicht mehr, sondern die Person sollte sagen, dass sie genervt ist (oder mindestens in den Chat schreiben). Wenn ein:e Moderator:in erfahren möchte, wie die Gruppenstimmung ist, genügt es nicht mehr, in die Gruppe hineinzuspüren. Vielmehr sollte man einmal explizit reihum eine Frage stellen oder per Handzeichen ein Feedback einholen (“Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie ist euer Energielevel”, oder ähnliches). Und ein Team tut gut daran, einmal am Tag ein 15-minütiges CheckIn zu machen, um genau solchen Faktoren Raum zu geben.
Regeln geben Sicherheit
Was ist erlaubt – und was nicht? Ist hier ein Safe Space, in dem ich als Homosexueller, als Trans-Person, als PoC oder Angehörige:r einer anderen Minderheit offen meine Meinung sagen kann? Gibt es Regeln, auf die ich mich berufen kann, wenn ich beleidigt oder angefeindet werde? Was sind die unausgesprochenen Regeln des Miteinanders?
Wie in Offline-Räumen und in unseren Gesellschaften und Gemeinschaften, die wir auf der ganzen Welt so aufgebaut haben, gilt auch in digitalen Räumen: Wo Regeln existieren, gibt es weniger Missverständnisse. Wie ihr in den digitalen Räumen zu Regeln kommt, ist euch überlassen. Vielleicht wollt ihr sie gemeinsam mit allen Mitgliedern eures digitalen Raumes ausdiskutieren, gemeinsam verfassen und dann auch (virtuell) unterzeichnen?
Dann stellt sich allerdings die Frage, was passiert, wenn eine neue Person zu eurer Gruppe hinzustoßen will. Als Admin eines digitalen Raums könnt ihr die Regeln oder eine Netiquette auch selbst erstellen – bei Regelbruch macht von eurem Hausrecht Gebrauch. Egal wie, eines sollte klar sein: Die Menschenrechte und das Grundgesetz gelten auch in (eurem) digitalen Raum. Man sollte im Digitalen vieles neu denken. Doch in diesem Fall gilt ausnahmsweise: Was sich offline bewährt hat, bleibt auch online die Grundlage unseres Handelns.
Soziales im Digitalen
Hier findet ihr alle Beiträge der Serie.