
Anna-Katharina “Kathy” Meßmer liebt das Internet. Der digitale Raum ist ihr Habitat und Teil ihrer Welt, der für sie nicht mehr wegzudenken ist. Doch die Soziologin sieht diesen Ort durchaus auch kritisch: „Wir haben zunächst geglaubt, das Internet habe per se ein utopisches Potenzial. Wir haben gehofft, alle könnten hier ihre Stimme erheben und könnten auch frei von Diskriminierungen gehört werden. Heute wissen wir: Das ist nicht so.“
Die 37-Jährige erinnert sich genau an die Häme, die Bundeskanzlerin Angela Merkel 2013 für ihre Feststellung kassierte, das Internet sei „für uns alle Neuland“. Kathy sagt, damit habe Merkel „aber tatsächlich recht gehabt – wir wissen doch alle immer noch nicht, nach welchen Spielregeln unser digitales Zusammenleben funktionieren kann und sollte“. Auch konstatiert sie, dass die Gesellschaft gerade „in der digitalen Pubertät“ sei und jetzt den Schritt zum Erwachsenwerden vollziehen müsse.
Dabei gerät Kathy immer stärker ein Bereich in den Blick, der lange vernachlässigt wurde: die digitale politische Bildung. „Wenn wir über Medienkompetenz gesprochen haben, haben wir lange gemeint, dass Menschen in der Lage sein müssten, eine App zu installieren oder mit einer Anwendung klarzukommen.“ Erst in den letzten Jahren habe sich die Einsicht durchgesetzt, dass es mehr brauche als nur die Fähigkeit, mit Smartphone oder Tablet umzugehen; dass Medienkompetenz auch einen demokratisch-politischen Kompass brauche.
Von der Politik in die Forschung
Dieses Umdenken in der breiten Öffentlichkeit voranzutreiben, ist Kathys täglicher Job. Als Projektleiterin für digitale Nachrichten- und Informationskompetenz bei der Stiftung Neue Verantwortung untersucht sie, welches Wissen für einen bewussten und kritischen Umgang mit Medien nötig ist. Um sich hier thematisch so tief wie möglich eingraben zu können, entschied sie sich im vergangenen Jahr für einen, wie sie selbst sagt, „ungewöhnlichen Karriereschritt“: Sie wechselte von der Geschäftsführung eines Forschungsinstituts in die Projektarbeit. Managementaufgaben zugunsten inhaltlichen Arbeitens aufgegeben zu haben, habe sie „extrem glücklich“ gemacht. Seither, sagt Kathy, vergehe kein Tag, „an dem ich morgens nicht mit dem Gefühl ins Büro fahre, damit genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben“.
Die Berlinerin hat schon immer ausprobiert, welcher Job am besten zu ihr passt: Nachdem sie 2008/09 die SPD-Kandidatin Gesine Schwan in ihrer Bewerbung als Bundespräsidentin begleitet hatte, kam sie zu dem Schluss, dass der klassische Politikbetrieb „mir einfach nicht liegt“ und wechselte in die Wissenschaft, wo sie im Rahmen eines Forschungsprojekts ihre Promotion zum Thema „Überschüssiges Gewebe. Intimchirurgie zwischen Ästhetisierung und Medikalisierung“ schrieb und sich dabei intensiv der Frage widmete, wie Technologien gesellschaftliche Schönheitsideale beeinflussen. Kathy erinnert sich daran, dass es nicht leicht gewesen sei, diese künstlichen Ideale nicht zu internalisieren „und sich vielmehr dagegen zur Wehr zu setzen“.

Frauen sind im Netz stärker bedroht
Kathy will das Internet zu einem besseren, faireren Ort als bisher machen. Denn sie hat am eigenen Leib erfahren, wie die Online-Debattenkultur Menschen – und dabei vor allem Frauen und anderen Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind – zusetzen kann. 2013 initiierte sie mit Mitstreiterinnen den Hashtag #aufschrei, der Menschen dazu ermunterte, sexistische Erfahrungen in den sozialen Netzwerken zu teilen. Damals erlebte auch sie ihren ersten Shitstorm – und erinnert sich gut. „Ein Freund hat mir damals angeboten, meinen Account zu übernehmen, um mir die Flut an beleidigenden Nachrichten und Posts zu ersparen. Nach 24 Stunden hat er mich angerufen und mir gesagt, so etwas Krasses habe er bisher noch nicht erlebt.“
Frauen würden im Internet in einer „komplett anderen Qualität“ angegangen als Männer, sagt die Soziologin, „die Angriffe sind kaum inhaltlich oder auf einer sachlichen Ebene, sie erfolgen im Grunde fast immer auf einer persönlichen Ebene, sie sind stark sexualisiert und fast immer gewalttätig“. Diese Erfahrung habe sie „fundamental verändert“. Sie sei sehr viel skeptischer und misstrauischer geworden und es habe erhebliche Anstrengungen gebraucht, „mir die Offenheit zurückzuerobern, die ich eigentlich immer hatte“. Das Internet, so Kathy nach ihren vielfältigen Erfahrungen, sei eben nicht die bessere Welt.

(Foto: sandrahermannsen/fsf)
Die Fülle an Informationen ordnen
Online sei die Gesellschaft mit den gleichen Problemen konfrontiert wie im Analogen, ergänzt sie. „Und das ist ja auch logisch: Technologie ist nicht neutral. Wenn Menschen, die rassistisch oder frauenfeindlich denken, Algorithmen programmieren, dann werden sich ihre Ansichten in der Technik spiegeln. Das geschieht oft sogar ganz unbewusst. Um analog wie digital eine gleichberechtigte Gesellschaft zu schaffen, müssen wir uns unserer unbewussten Stereotype bewusst werden, wir müssen Dinge verlernen und aktiv Diskriminierungen entgegen steuern. Das ist immer auch Arbeit. Das passiert nicht einfach von selbst durch neue Technologien.“
Die Gesellschaft müsse sich darüber im Klaren sein, dass die digitale Öffentlichkeit stark von den ökonomischen Interessen der Plattformen, auf denen sie stattfinde, getrieben und nicht per se demokratisch gestaltet sei. In einer Zeit, in der alle Menschen selbst senden und publizieren und auf eine Vielzahl von Nachrichtenquellen zugreifen könnten, bräuchten Bürger:innen „völlig neue Fähigkeiten“, um selbst die Zuverlässigkeit von Quellen beurteilen oder Informationen überhaupt erkennen, einordnen und verifizieren zu können. Das aber sei die demokratische Grundlage dafür, „fundierte Wahlentscheidungen zu treffen, an öffentlichen Debatten teilzunehmen, die Arbeit von Politiker:innen zu beurteilen und oder wie jetzt gerade in der Pandemie verlässliche Gesundheitsinformationen zu finden“.
Lobbyarbeit der anderen Art
Facebook, Google, Twitter und Co. stellten eine Infrastruktur zur Verfügung, die eben nicht neutral sei – aber die Bedingungen, unter denen sie heute funktionieren, könnten und müssten politisch gestaltet werden. Und das sei auch Aufgabe der digitalen Zivilgesellschaft. In deren Wahrnehmung gebe es häufig ein Missverständnis: „Es werden oft nur die wahrgenommen, die in den Medien präsent sind und nach außen kommunizieren. Aber gerade in diesem Bereich findet ganz viel hinter den Kulissen statt.“ Ihre Stiftung etwa bringe immer wieder Politik, Plattformen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft an einen Tisch, um die Diskussion zu versachlichen. Ziel sei es, politische Entscheidungsträger:innen mit guten Empfehlungen zu versorgen, die das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen.
Denn bei aller Kritik ist Kathy zuversichtlich. Die Digitalisierung habe die gesellschaftliche Spaltung nicht verursacht, sondern einfach nur sichtbarer gemacht. „Meine Eltern kommen vom Dorf. Dort konnte man früher zum Beispiel in der Kneipe sehen, wie weit etwa Groß- und Kleinbauern voneinander entfernt waren. Die saßen nicht gemeinsam am Stammtisch, sondern da gab es eine klare hierarchische Spaltung. Heute sind die Kontaktmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Menschen und Milieus viel größer.“ Menschen würden sich über Ländergrenzen hinweg zusammenschließen, um gemeinsame Interessen zu verfolgen oder für ihre Rechte zu kämpfen: „Ich bleibe trotz allem Optimistin! Da gibt es noch ganz viel positives Potenzial, wir müssen es nur nutzen.“

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International Lizenz.


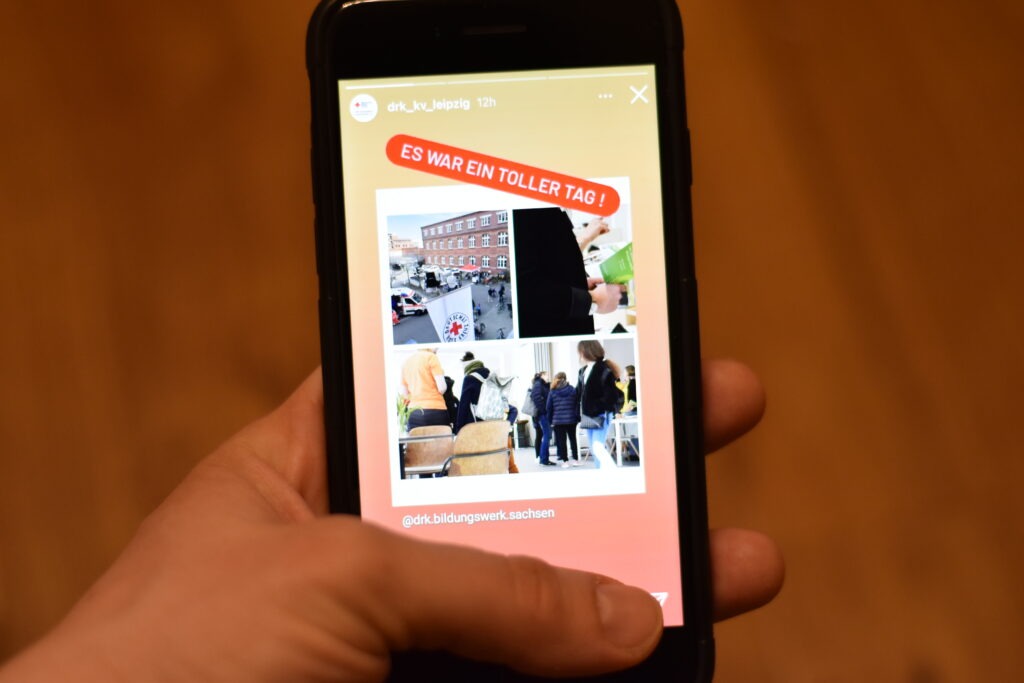


 gefördert durch
gefördert durch 