
Es ist nicht so, dass Julia Kloiber etwas gegen neue Technologien hätte. Das wäre auch absurd: Immerhin ist die 34-Jährige studierte Informationsdesignerin und Gründerin des Superrr Lab, einem feministischen Think Tank, der an der Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft arbeitet. Julia ist also schon von Berufs wegen Fan der Digitalisierung – aber deshalb nicht unkritisch. Die Digitalisierung könne „das langweiligste Thema der Welt“ sein, sagt sie: wenn man sie allein durch die technologische Brille betrachte. Wirklich spannend werde sie dann, wenn sie mit anderen Themen verknüpft und unter dem Aspekt diskutiert werde, wie sich dadurch der Alltag von Menschen und demokratische Teilhabe verbessern lasse.
Diese Fragen treiben Julia seit Jahren an. Nach dem Masterstudium arbeitete die Österreicherin als Projektleiterin für die Open Knowledge Foundation. Sie habe sich immer gefragt, wie sie „Kampagnen und Projekte aus der Zivilgesellschaft zu wichtigen Themen und Fragestellungen genauso gut gestalten kann wie kommerzielle Kampagnen großer Unternehmen“ – auch wenn den Non-Profit-Organisationen dafür nicht annähernd das gleiche Budget zur Verfügung steht.
Denn Julia ist davon überzeugt, dass technische und digitale Tools nur dann wirklich wertvoll sind, wenn sie dafür genutzt werden, die Gesellschaft besser zu machen. Konkret bedeutet das: Sie sollen den Alltag der Bürger:innen vereinfachen, mehr Teilhabe ermöglichen, die Transparenz von Entscheidungen von Politik oder Verwaltung erhöhen. Das werde nicht per se durch immer abgefahrenere Anwendungen oder krasse Geräte erreicht, sondern durch den Einsatz geeigneter Tools, die zum Teil schon lange bestehen. Julia nimmt dafür zuallererst drei Dinge in den Blick: Es brauche „Open Mind“, also die Bereitschaft, sich auf Digitalisierung einzulassen, „Open Data“, also zugängliche Informationen und deren allgemeinverständliche Aufbereitung, und „Open Source“, also die nötigen Werkzeuge, um mit den Daten arbeiten zu können.
Tools sollen konkret helfen
All das sei nötig, um etwa Steuergelder effizient zu nutzen, etwa in Form von einfach zugänglichen Systemen, in denen Eltern sich über freie Kitaplätze informieren, Radfahrer:innen online einsehen können, welche Routen sie meiden sollten, oder Künstler:innen Informationen über das Budget ihrer Stadt erhalten können – schlicht Dinge also, die das Leben vieler vereinfachen würden und Grundlage für eine informierte Mitbestimmung sind.
Es störe sie, sagt Julia, dass die Diskussion um die Vorteile der Digitalisierung allzu oft vor allem aus der Perspektive der Effizienz geführt würden. „Wir sind häufig getrieben von einer Vorstellung, in der Technologie mit Effizienz gleichgestellt ist.“ Mit Hilfe von Technologie würden wir bestimmte Dinge optimieren wollen. Das komme nicht von ungefähr: „Computer wurden genau zu diesem Zweck erfunden – nämlich dazu, bürokratische Prozesse zu automatisieren und effizienter zu machen“, so Julia. Dabei aber werde ein großes Potenzial übersehen: „wie der vernetzte Computer uns dabei helfen kann, als Gesellschaft zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren, unser kreatives Potenzial auszuschöpfen.“ In vielen Bereichen, wie zum Beispiel im Bildungsbereich gebe es Möglichkeiten, den Computer kreativ einzusetzen und die Fähigkeiten der Menschen zu erweitern; etwa in dem der Computer als Tool eingesetzt werde, mit dem wir malen, Sounds aufnehmen und elektronische Musik erzeugen – oder mit dem Menschen in der Pandemie über Kontinente hinweg als Orchester zusammen musizieren. „Meiner Meinung nach müssen wir über das Effizienz- und Optimierungspotenzial hinausdenken und neue Technologien dafür nutzen, um die wirklich großen Herausforderungen anzugehen: Klimawandel zum Beispiel. Dafür brauchen wir nicht nur Daten, sondern auch neue Formen der digitalen Zusammenarbeit, damit möglichst viele Menschen ihre Kompetenzen und Ideen einbringen können.“

Ein übersehenes Potenzial
Julia engagiert sich deshalb in unterschiedlichen Initiativen. So überzeugte sie 2016 das Bundesbildungsministerium vom Förderprogramm „Prototype Fund“, das gemeinnützige Open-Source-Projekte von Einzelpersonen oder kleinen Teams fördert. Früher seien diese Menschen meist von vornherein von einer Förderung ausgeschlossen gewesen, weil das Geld an große Unternehmen oder Forschungsgruppen gegangen sei; da habe man auf viel Potenzial verzichtet. Nun werde in die Pflege von Open-Source-Infrastruktur investiert, erzählt Julia, etwa in ein technisches System zum Einreichen von Informationen durch Whistleblower. „Und wir wissen alle, wie wichtige deren Daten für unsere Demokratie sind.“ Immer wieder kehrt Julia gedanklich zu diesem Punkt zurück: Dass es nicht darum geht, über den Prozess der Digitalisierung zu immer besserer und ausgefeilterer Technik zu kommen, sondern zu einer gerechteren Welt.
Dafür, davon ist sie überzeugt, braucht es stärker als bisher positive Visionen. Julia stört sich daran, dass die Digitalisierung allzu häufig als notwendiges Mittel gesehen werde, um Katastrophen abzuwenden. „Wir brauchen neue Visionen. Wenn die Menschen Daten benutzen sollen und wollen, um die Welt zu gestalten, dann müssen wir sie auch dazu ermutigen, sich eine wünschenswerte Welt vorzustellen. Dann kommen wir zu realistischen Utopien.“
Das Ziel ist eine gerechtere Welt
Für die Unternehmerin, die heute in Berlin lebt, ist eines klar: Dafür braucht es viel mehr als bisher Geschlechtergerechtigkeit. Julia träumt von feministischer Technologie und beklagt, es gebe einen „Gender-Data-Gap“. Frauen und Minderheiten seien in bestimmten Datensätzen nach wie vor unterrepräsentiert – große Teile der Welt seien aus einer männlichen Perspektive konstruiert. „Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass Daten kein objektives Bild der Wirklichkeit liefern und dass neue Technologien häufig von homogenen Teams für bestimmte Zielgruppen entworfen werden. Das führt dazu, dass viele Menschen außen vor bleiben.“ Insbesondere der dritte Sektor könne hier eine stärkere Rolle spielen, glaubt Julia. Sie findet es wichtig, dass die – vor allem die digitale – Zivilgesellschaft „nicht nur ein nettes Add-on ist, das die Politik zu Gesprächen einlädt, sondern dass sie sich wirklich gestaltend einbringt“.
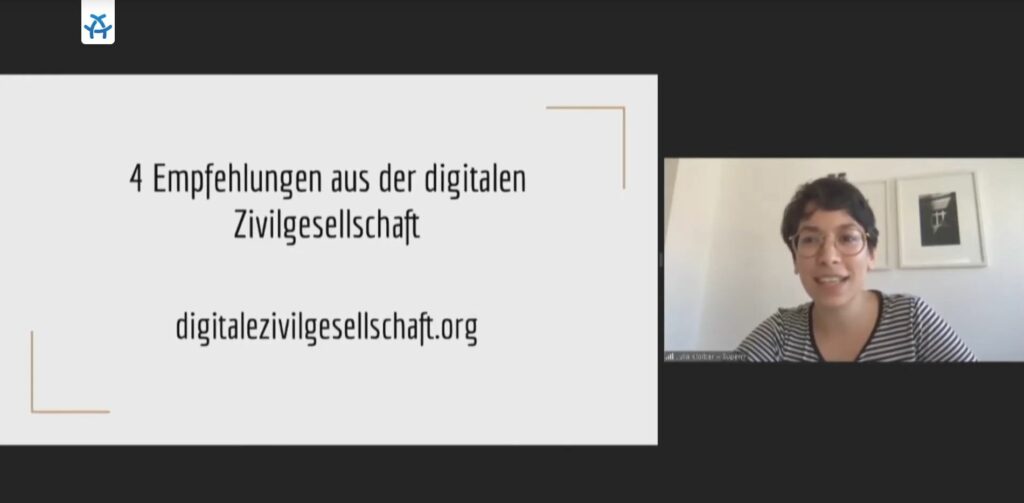
Gemeinsam mit Mitstreiter:innen hat sie deshalb in der Corona-Krise eine Kampagne aufgesetzt, die für eine unabhängige digitale Infrastruktur und den freien Zugang zu Wissen kämpft und ihre Forderung formuliert: „Der Aufbau eines gemeinwohlorientierten digitalen Ökosystems muss endlich politische Priorität bekommen.“ Von den Umstellungen zur Eindämmung des Virus hätten nämlich bislang vor allem die großen Technologiekonzerne profitiert. Die Verlagerung des Lebens in die digitale Sphäre habe ihnen größere Marktanteile, Nutzungszahlen und Datensammlungen beschert. Um in Krisenzeiten nicht von ihnen abhängig zu sein, brauche es „ein aktives digitales Ökosystem“ mit wirklichen Wahlmöglichkeiten , erklärt Julia. Eine unabhängige und zuverlässige digitale Infrastruktur sei „auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“. Denn der Zugang zu Wissen und digitalen Werkzeugen entscheide, „wer in Zukunft mitgestalten kann und wer abgehängt wird“. Und darum gehe es im Kern, nicht um Tools oder Technik.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International Lizenz.



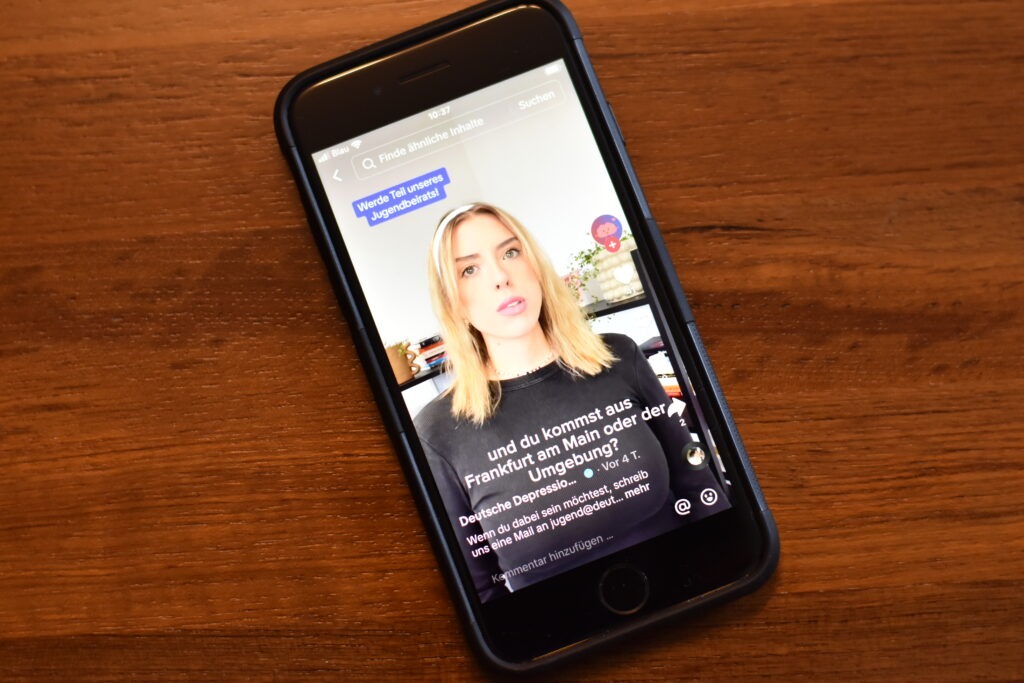

 gefördert durch
gefördert durch 